Die Strategie der EU für umweltfreundliche und kreislauffähige Produkte
Die Verordnung über die umweltgerechte Gestaltung nachhaltiger Produkte (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), die am 18. Juli 2024 in Kraft trat, ist ein zentraler Bestandteil der Strategie der Europäischen Kommission für umweltfreundlichere und kreislauffähige Produkte. Produkte und ihre Nutzung können erhebliche Umweltbelastungen verursachen. Der Konsum in der EU trägt daher maßgeblich zum Klimawandel und zur Umweltverschmutzung bei.
Die ESPR ist Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets, das entscheidend zur Umsetzung der Ziele des Aktionsplans für eine Kreislaufwirtschaft 2020 beiträgt. Diese Verordnung unterstützt die EU dabei, ihre Umwelt- und Klimaziele zu erreichen, die Kreislaufwirtschaftsquote zu verdoppeln und die Energieeffizienzziele bis 2030 zu verwirklichen.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Digitaler Produktpass (DPP)
Der Digitale Produktpass (DPP) hat seine Wurzeln und Impulse aus der Umweltpolitik - sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Auf EU-Ebene sind die wichtigsten politischen Rahmenwerke der Green Deal (seit 2019), der Circular Economy Action Plan (2020) und die geplante EU-Ökodesign-Verordnung ESPR (Ecodesign for Sustainable Products 2022).
Der DPP ist der digitale Ausweis für Produkte, Komponenten und Materialien. Es werden zentral alle relevanten Produktinformationen gespeichert mit dem Ziel die Nachhaltigkeit von Produkten zu fördern, ihre Kreislauffähigkeit zu steigern und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu verbessern.
Die Informationen im DPP werden elektronisch verfügbar sein, was es Verbrauchern, Herstellern und Behörden ermöglicht, fundierte Kaufentscheidungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit und Rechtskonformität zu treffen. Darüber hinaus wird der Zoll in der Lage sein, automatisch das Vorhandensein und die Echtheit des DPP bei importierten Produkten zu überprüfen. Welche Informationen im DPP enthalten sein müssen, wird von der Kommission in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Interessengruppen, Branchenvertretern und den Behörden festgelegt und ist abhängig von der Art des jeweiligen Produkts.
Ein digitaler Produktpass (DPP) stellt die digitale Identität eines physischen Produkts dar. Er erfasst zentral sämtliche Produktdaten entlang des gesamten Wertschöpfungs- und Lebenszyklus und macht dabei nur die für die jeweiligen beteiligten Akteure relevanten Informationen zugänglich. Man kann sich den digitalen Produktpass als digitalen Zwilling des physischen Produkts vorstellen, der den gesamten Lebenszyklus des Produkts widerspiegelt.
Dies umfasst alle Phasen von der Herstellung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung oder Wiederverwertung. Es ist, als hätte jedes Produkt einen umfassenden digitalen "Lebenslauf", der jederzeit einsehbar ist.


Der aktuelle Stand der Politik
Konzepte und Definitionen zum DPP sind bereits ausgearbeitet und in verschiedenen politischen Richtlinien und Verordnungen fest verankert.
Die Europäische Kommission verfolgt derzeit mit dem DPP fünf wesentliche politische Ziele (CIRPASS 2023):
- Verbesserung der nachhaltigen Produktion
- Verlängerung der Produktlebensdauer und Optimierung der Produktnutzung
- Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten für Wirtschaftsakteure durch Kreislaufwerterhaltung und -gewinnung
- Unterstützung der Verbraucher bei der Auswahl nachhaltiger Produkte
- Unterstützung der Behörden bei der Überprüfung von Vorschriften
Eine der ersten Umsetzungen des DPP in der EU wird der sogenannte "Batteriepass" sein, wie es in Artikel 77 der neuen EU-Batterieverordnung festgelegt ist. Der Batteriepass, dessen verpflichtende Einführung bis zum 18. Februar 2027 geplant ist, wird als elektronischer Datensatz dienen, der Informationen sammelt, die während des gesamten Lebenszyklus einer Batterie anfallen.
Es folgen Zwischenprodukte, wie Eisen, Stahl und Aluminium, sowie Endprodukte wie Textilien, Möbel, Reifen, Reinigungsmittel, Farben, Schmiermittel, Chemikalien, Energieprodukte, Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie und andere Elektronik.
Woher bekommen Unternehmen die Daten für den Produktpass?
Eine der größten Herausforderungen bei der Erstellung eines digitalen Produktpasses besteht darin, sämtliche relevanten Informationen zentral zu erfassen, zu sammeln und zu konsolidieren.
Externe Datenquellen von Zulieferer und Partnerunternehmen:
- Zulieferdaten: Diese Daten werden von den Zulieferern zur Verfügung gestellt und enthalten Informationen über die Herkunft und bisherige Verarbeitung der Materialien.
- Partnerdaten: Partnerunternehmen können Daten zur Entsorgung oder Wartung von Produkten bereitstellen. Diese Informationen variieren je nach Produkt und Unternehmensorganisation.
- Interne Daten, sind Informationen, die während des gesamten Wertschöpfungsprozesses innerhalb des Unternehmens generiert werden:
- Produktionsdaten: Diese Daten stammen aus der Produktionsphase und können Informationen über verwendete Materialien, Produktionsprozesse, Maschinen- und Energieverbrauch und vieles mehr enthalten.
- Qualitätskontrolldaten: Diese Informationen werden während der Qualitätsprüfung und -sicherung generiert und können Details zur Produktleistung, zu Tests und zu Compliance-Themen enthalten.
- Service-Daten: Diese Daten umfassen Informationen über den Verkauf, die Lieferung und den Service von Produkten.
Es ist essenziell, klare und strukturierte digitale Prozesse im Betrieb zu etablieren, um Daten effizient erfassen und verwalten zu können. Unstrukturierte Daten in Textform oder analog erfasste Daten auf Papier sind nicht geeignet.
Mehrwerte des Digitalen Produktpass
Durch die Bereitstellung detaillierter Informationen über Herstellung, Materialien und Umweltauswirkungen ermöglicht der DPP Unternehmen und Verbrauchern, nachhaltige und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Dies fördert umweltfreundliche Produktionspraktiken und Produktdesigns.
Zudem kann der DPP die Effizienz beim Recycling und der Entsorgung steigern, während gleichzeitig Ressourcen und Kosten optimiert werden. Die durch digitale Produktpässe bereitgestellten Daten tragen außerdem dazu bei, die Wiederverwendung von Produkten und Materialien zu vereinfachen.
Durch die Bereitstellung detaillierter Produktinformationen können gezielte und kundenorientierte Angebote entwickelt werden, die neue Geschäftsmodelle rund um das Produkt und die Kreislaufwirtschaft ermöglichen.
Die verbesserte Datenverfügbarkeit und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette tragen zur Effizienzsteigerung bei, was zu Kosteneinsparungen und optimierten Produktionsprozessen führt. Ein weiterer strategischer Vorteil ist die erhöhte Resilienz der Lieferkette. Die verbesserte Datenverfügbarkeit ermöglicht es Unternehmen, potenzielle Risiken in der Lieferkette schneller zu erkennen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen.
Dank der verbesserten Transparenz entlang der Wertschöpfungskette können Unternehmen sicherstellen, dass sie auch die Bestimmungen der Supply Chain Due Diligence sowie des Corporate Sustainability Reportings (CSR) erfüllen.
DPP-Kennzeichnung mit Auto-ID-Technologie
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Weiterverarbeitung aller Daten in den nachgelagerten IoT-Systemen. Physische Objekte sollen mithilfe von RFID/NFC Technologie und/oder 2D-Codes eindeutig, langlebig und mit einer einheitlichen Syntax identifiziert werden. Dadurch werden die gekennzeichneten Objekte nahtlos in den IoT-Systemkreislauf integriert.
Einige allgemeine Anforderungen an die Dateneingabe und den Datenschutz sind jedoch bereits festgelegt. Gemäß dem Vorschlag der Europäischen Kommission für Ökodesign nachhaltiger Produkte gelten folgende allgemeine Anforderungen an einen Digitalen Produktpass:
1. Der DPP muss mit einem digitalen Datenträger über einen (eindeutigen) Identifikator verbunden sein. Der Datenträger und die Produktkennung sollen der Normreihe (ISO/IEC) 15459 entsprechen.
2. Alle Informationen im DPP müssen sich auf ein spezifisches Produkt oder die Chargennummer beziehen. Die Informationen müssen folgenden Anforderungen genügen
- Offener Standard
- Maschinenlesbar
- Strukturiert
- Durchsuchbar für alle Beteiligten
3. Der Zugang zu den Informationen im DPP wird geregelt. Dies wird in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission festzulegenden Anforderungen geschehen.
Warum eine eindeutige Identifikation bzw. Sprache so wichtig ist:
Gemäß den bevorstehenden DPP-Verordnungen wird mindestens auf Chargenebene, wahrscheinlich jedoch auch auf der Ebene der Produkteinheit, ein eindeutiger und unverwechselbarer Datenträger erforderlich sein. Dieser Datenträger muss zudem sicher und maschinenlesbar sein und gleichzeitig Transparenz bieten, sodass relevante Produktdaten bei Bedarf von jedem eingesehen werden können.
Eine eindeutige und standardisierte Identifikation ist in allen Prozessen von großem Vorteil. Informationen wie Zeichnungen, Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten können in Datensystemen erfasst und mit einem Identifikationsmedium, idealerweise der UID (=weltweit einmalige Nummer im Chip) eines RFID/NFC Transponder, verknüpft werden.
Der Prozess funktioniert auch umgekehrt: Informationen aus Datensystemen, wie Prüfberichte, Inventurbestände oder Protokolldokumentationen, können auf den RFID/NFC Transponder zurückgeschrieben werden. Für die Identifikation entlang des gesamten Wertschöpfungszyklus eines Objektes reicht somit der RFID/NFC Identifikationsträger aus, um allen Beteiligten der Prozesskette Informationen zu einem physischen Objekt bereitzustellen und diese kontinuierlich zu aktualisieren.
Eindeutige und einprägsame Markierung
Eine eindeutige Identifikation ist essenziell für den Zugriff und die Pflege von Informationen des digitalen Zwillings. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer einfachen Darstellung und Umsetzung. Die neu entwickelten Logos, die die Globally Biunique ID eindeutig kennzeichnen und somit einen neuen Industriestandard in der Prozessindustrie einführen, erfüllen diese Anforderungen.
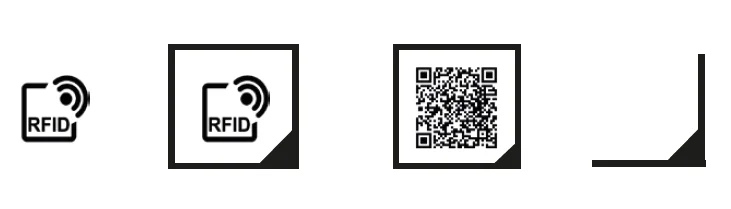
Anwender, Kunden, Recycling Partner, Produzenten, Zwischenhändler, Zulieferer, Groß- und Einzelhändler können schnell und einfach sicherstellen, dass der richtige RFID/NFC Transponder oder 2D-Code ausgelesen wird. Verwechslungen sind ausgeschlossen, wodurch die Fehlerquote deutlich sinkt.
Neue Möglichkeiten durch RFID/NFC Technologie
Da physische Objekte oft in stark verschmutzten oder schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden, bietet die kontaktlose Identifikation über Distanz mittels RFID/NFC Technologie erhebliche Vorteile gegenüber dem 2D-Code. NFC-Technologie wird von vielen Smartphones und anderen mobilen Lesegeräten unterstützt. Ein RFID/NFC Transponder wird am physischen Objekt angebracht, wobei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen – er kann geklebt, genietet, in ein Material eingebettet oder mit Kabelbindern befestigt werden.
Unsere RFID/NFC Transponder werden vielfältigen Anforderungen gerecht
Die optimale Anbringung am Objekt ist ebenso wichtig wie die richtige Betriebsfrequenz, Chip-Codierung, Lesbarkeit mittels unterschiedlichster RFID/NFC Lesegeräte, Auswahl der für die Umgebungsbedingungen geeigneten Materialien und die hohe mechanische, thermische und chemische Beständigkeit.
Die RFID/NFC Transponder von smart-TEC – ob klassische Metalltypenschilder, Digitale Typenschilder, Industrietransponder oder smart-LABEL mit integrierter RFID/NFC Technologie – erfüllen all diese Anforderungen. Alle Bedürfnisse in Bezug auf Form, Farbe, Größe, Aufdruck, Material, Befestigung sowie thermische, chemische und mechanische Beständigkeit werden abgedeckt.